Joachim Wedekind hat in seinem Blog (hier) auf ein interessantes Buch zum Einfluss von PowerPoint auf unsere Denk- und Sprechgewohnheiten aufmerksam gemacht, das ich mir gleich mal bestellt habe. Das Thema ist nicht neu, aber das zugrundeliegende Problem nach wie vor ungelöst: Wie nutzt man eine Software-Anwendung wie PowerPoint so, dass es dem, was man sage will, dient und nicht umgekehrt? Ein guter Tipp ist hier auch der Link zu einem SZ-Artikel in einem Kommentar zum Blog-Post (hier). Dem Autor des Beitrags, Thomas Steinfeld, ist vor allem der Unterschied zwischen einem Vortrag und einer Präsentation wichtig: „Es ist offenbar selbstverständlich geworden, der Rede nicht zu vertrauen, so sehr, dass deren Eigenarten gar nicht mehr bedacht werden, unter der Voraussetzung, auch sie sei eine ´Präsentation´. Wenn nämlich beides – der allein in Worten gestaltete und der von Bildern und Schrift ´unterstützte´ Vortrag – als ´Präsentation´ betrachtet wird, gewinnt das Zeigen und Werben, das Anpreisen durch ´Visualisierung´, einen entscheidenden Vorrang gegenüber dem Wort, das dann nur als Mittel behandelt wird. Oder anders gesagt: Wer eine Rede für eine Präsentation hält, stiehlt sich aus der Gegenwart seines Vortrags davon, indem dieser nur auf etwas außerhalb Befindliches verweist. Er wäre auch fähig, Verkehrsschilder, Piktogramme oder Heiligenbilder (denn um mehr geht es ja, streng genommen, bei Powerpoint-Präsentation nicht) mit Argumenten zu verwechseln.“
Nun, es gibt sicher eine ganze Reihe von Ausnahmen, bei denen ein gut gemachtes Bild, vor allem auch eine (logische) Grafik, das Mitdenken beim Zuhören unterstützt. Gute Erfahrungen habe ich auch damit, wenn man komplexe Zusammenhänge visualisiert und genau dies schrittweise aufbaut, was aber eine ganz genaue Abstimmung zwischen Wort und Bildaufbau verlangt. Öfter aber trifft man auch an Universitäten (nicht nur in Unternehmen) auf das Phänomen des „Folien-Besprechens“ – und hierzu halte ich Steinfelds Diagnose für sehr gelungen.
Das blinde Vertrauen auf die Folie gar als Lektüre-Grundlage für Studierende war einer meiner Gründe für den Versuch einer Art „Podcast-Text-Wiki-Tutorium“-Vorlesung ;-), über die ich hier schon mehrfach berichtet habe (z.B. hier). Am 10. März werde ich auf dem „2. Symposium E-Learning an Hochschulen. Sind die Lehrjahre vorbei?“ an der TU Dresden (hier das Programm) unsere Evaluationsergebnisse und dann natürlich auch eine Zusammenfassung hier online verfügbar machen. Eines meiner Ziele war es, Studierende dazu zu motivieren, sich mit einer deswegen auch stark reduzierten TEXTauswahl zu beschäftigen, sie darin durch Podcasts zu unterstützen und mit einem Wiki zu aktivieren – anstatt Folien zu „lesen“ und auswendig zu lernen. Ob und wie es gelungen ist, einen Sieg über die PowerPont-Kultur davonzutragen, verrate ich im März.
 2010 – ein Jahr der Festschriften, könnte man fast schon sagen. Anlässlich des 65. Geburstages von Renate Schulz-Zander hat Birgit Eickelmann einen Band mit dem Titel „Bildung und Schule auf dem Weg in die Wissensgesellschaft“ beim Waxmann Verlag herausgegeben. Auch hier war es daher nicht möglich, den Beitrag von Sandra Hofhues und mir als Preprint vorher (und man sieht am Datum, dass das schon etwas läger her ist) zugänglich zu machen. Daher also auch das wieder „nachträglich“.
2010 – ein Jahr der Festschriften, könnte man fast schon sagen. Anlässlich des 65. Geburstages von Renate Schulz-Zander hat Birgit Eickelmann einen Band mit dem Titel „Bildung und Schule auf dem Weg in die Wissensgesellschaft“ beim Waxmann Verlag herausgegeben. Auch hier war es daher nicht möglich, den Beitrag von Sandra Hofhues und mir als Preprint vorher (und man sieht am Datum, dass das schon etwas läger her ist) zugänglich zu machen. Daher also auch das wieder „nachträglich“.
 wurde
wurde 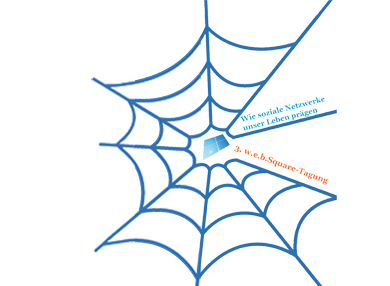 Zum dritten Mal fand im Rahmen unseres Studiengangs „Medien und Kommunikation“ gestern eine studentische Tagung statt, nämlich die dritte
Zum dritten Mal fand im Rahmen unseres Studiengangs „Medien und Kommunikation“ gestern eine studentische Tagung statt, nämlich die dritte  Diese
Diese