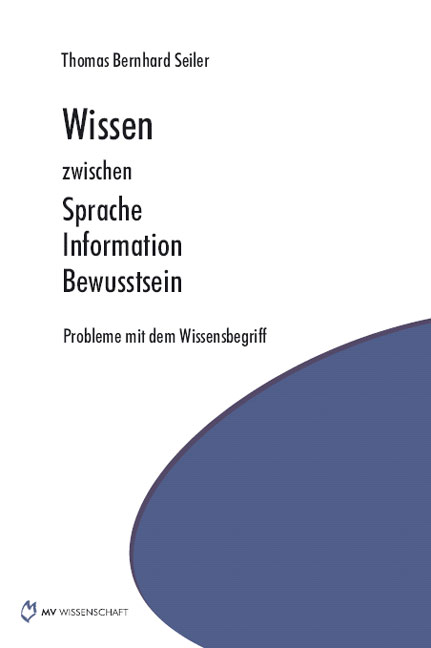Viele netzaffine ZEIT-Leser werden in den letzten drei Wochen die drei Ws in Form der Beilage „ZEIT Internet spezial“ gesammelt haben. Ich habe nicht genau nachgeschaut, ob alle Artikel auch online sind; der Artikel, zu dem auch Herr Spitzer wieder Beiträge geliefert hat (in Form eines offenbar im Hintergrund gehaltenen Interviews) aber schon: Unter dem Titel „Verzettelt im Netz“ (online hier) wird diskutiert, wie die Online-Welt unsere Sprache und unser Denken verändert. Eine durchaus sinnvolle Frage, denn natürlich ändern sich Menschen (sowie ihr Denken, Sprechen, wohl auch Handeln) auch mit technischen Entwicklungen. Leider aber schwingt sofort die kulturpessimistische Frage mit, ob am Ende nicht mehr wir den Computer beherrschen, sondern er uns (eine alte Angst, welche die Hüter z.B. von Kirche und Moral ja bekanntlich schon bei Büchern hatten).
Heute fragt man bei solchen Herausforderungen keineswegs mehr Soziologen, die die Gesellschaft beobachten, schon gar keine Pädagogen, wenn sie nicht dem PISA-Konsortium angehören, und Psychologen nur, wenn sie sich zur biologischen Psychologie bekennen. Nein, man fragt vor allem die Neurowissenschaftler, weil die auf harte Daten zurückgreifen und uns endlich erklären können, warum der Mensch ist, wie er ist und was man dagegen tun kann, dass ihn die Technik nicht auffrisst. Also zunächst mal sollte man laut Spitzer keinesfalls auf Medienpädagiogen hören, denn – wie man da lesen kann: „Diese sogenannten Medienpädagogen reden fast alle Stuss, weil sie von Softwarekonzernen finanziert werden.“ Oh Treffer – auch wir haben seit vier Jahren ein Projekt mit Intel laufen. Gut, das ist zwar kein Software-Hersteller, aber Chips braucht man ja auch für die Teufelsdinger. Alle Medienpädagogen sind also gekauft? Immerhin heißt es „fast alle“ … na dann.
Anbei, wen es interessiert, ein Kurzkommentar, um den mich vor einigen Wochen der Südkurier (gut, die Zeitung kannte ich vorher auch nicht, weil ich in Oberbayern südlich von München wohne) gebeten hatte: Anlass war mal wieder Spitzers legendäre Ausspruch, dass Computer dumm machen (hier der Text: machen-computer-dumm). Als Gegenseite sollte Herr Spittzer einen Kommentar liefern. Hat dann aber wohl (erheblich gemäßigter) eine Mitarbeiterin gemacht – das Blatt war wohl doch zu popelig.
 „Schulmeister bloggt“ …. ganz so kann man es noch nicht sagen, aber fast: Die Mitarbeiter im Team um Rolf Schulmeister betreiben seit April 2008 das ZHW-WebLog (ZHW steht für Zentrum für Hochschul- und Weiterbildung) und Rolfs erster Blog-Eintrag findet sich hier:
„Schulmeister bloggt“ …. ganz so kann man es noch nicht sagen, aber fast: Die Mitarbeiter im Team um Rolf Schulmeister betreiben seit April 2008 das ZHW-WebLog (ZHW steht für Zentrum für Hochschul- und Weiterbildung) und Rolfs erster Blog-Eintrag findet sich hier:
 Der Kunsthistoriker Jeffrey Hamburger ist Professor für Deutsche Kunst und Kultur an der Harvard Universität. In der letzten Ausgabe von
Der Kunsthistoriker Jeffrey Hamburger ist Professor für Deutsche Kunst und Kultur an der Harvard Universität. In der letzten Ausgabe von  Ich weiß ja nicht, was echte Fußballfans (kann ich mich jetzt nicht so hineinversetzen 😉 ) davon halten, aber: Wen es interessiert, was Fußball mit (Hochschul-)Didaktik zu tun hat, der kann ja VOR den nun beginnenden Spielen noch schnelll eine kleine Publikation der
Ich weiß ja nicht, was echte Fußballfans (kann ich mich jetzt nicht so hineinversetzen 😉 ) davon halten, aber: Wen es interessiert, was Fußball mit (Hochschul-)Didaktik zu tun hat, der kann ja VOR den nun beginnenden Spielen noch schnelll eine kleine Publikation der  Online und als Volltext erhältlich ist die Ausgabe der Zeitschrift „UNESCO heute“ zum Thema „Wissen im Web“. In 19 knappen Artikeln geht es um verschiedene Begriffe, Konzepte und Themen oder Herausforderungen in der Wissensgesellschaft mit Bezug auf das Internet, wobei einige bekannte Namen dabei sind. Ich wurde angefragt, zum Informations- und Wissensbgeriff zu schreiben – na ja, ein etwas trockenes Thema, was schade ist (kritische Statements sind da eher schwer unterzubringen), aber genau dafür haben sie halt offenbar noch jemanden gebraucht ;-). Es ist ja bekanntlich nicht so leicht, auf sehr begrenztem Raum für den interessierten Laien trotzdem nicht trivialisierend etwas auf den Punkt zu bringen. Ich werde die kommenden Tage mal schauen, wie es in diesem Heft den anderen so gelungen ist, dies zu erreichen. Ich fands gar nicht so einfach … (ich vermute aber, dass da auch Redakteure mitunter nachgeholfen haben).
Online und als Volltext erhältlich ist die Ausgabe der Zeitschrift „UNESCO heute“ zum Thema „Wissen im Web“. In 19 knappen Artikeln geht es um verschiedene Begriffe, Konzepte und Themen oder Herausforderungen in der Wissensgesellschaft mit Bezug auf das Internet, wobei einige bekannte Namen dabei sind. Ich wurde angefragt, zum Informations- und Wissensbgeriff zu schreiben – na ja, ein etwas trockenes Thema, was schade ist (kritische Statements sind da eher schwer unterzubringen), aber genau dafür haben sie halt offenbar noch jemanden gebraucht ;-). Es ist ja bekanntlich nicht so leicht, auf sehr begrenztem Raum für den interessierten Laien trotzdem nicht trivialisierend etwas auf den Punkt zu bringen. Ich werde die kommenden Tage mal schauen, wie es in diesem Heft den anderen so gelungen ist, dies zu erreichen. Ich fands gar nicht so einfach … (ich vermute aber, dass da auch Redakteure mitunter nachgeholfen haben).