Jetzt ist sie schon wieder vorbei – die GMW 2010 in Zürich. Es waren dichte drei Tage – vor allem auch wegen meiner Vorstandstätigkeit, die zusätzliche Sitzungen ab den Morgenstunden am Montag bescherte. Turnusmäßig endete jetzt im September 2010 meine Amtszeit und ich habe nicht noch einmal kandidiert, weil ich mich in den kommenden beiden Jahren sonst auf zu viele Dinge gleichzeitig konzentrieren müsste. Ich muss aber abschließend sagen, dass die beiden Jahre erfahrungsreich waren und die Arbeit im Vorstand fast immer viel Spaß gemacht hat, auch wenn wir nicht alles umsetzen konnten, was wir uns in den ersten Treffen so alles gedacht hatten. Aber ich denke, ein bisschen was haben wir schon verändert und das kann jetzt mit ein paar neuen Personen fortgesetzt werden. Das gilt ja z.B. schon mal für das Tagungsformat: Die abschließende Podiumsdiskussion am Mittwoch hatte gezeigt, dass das Konzept „educamp meets GMW“ (siehe z.B. hier) gut angekommen ist – natürlich inklusive konkreter Verbesserungsmöglichkeiten. Wenn man die GMW-Tagung mit anderen „traditionellen“ Tagungen vergleicht, dann denke ich schon, dass wir längst ein Klima erreicht haben, das sich deutlich von anderen unterscheidet – man nimmt das nur in der eigenen Community mitunter gar nicht mehr so recht wahr.
Was wird aus diesen drei Tagen besonders in Erinnerung bleiben? Erst mal am Montag am Ende des Educamps das überdimensionale Sofa – das war wirklich eine schöne (zufällig vorhandene) Kulisse, die zeigte, dass Räumlichkeiten und Sitzordnungen eine große Rolle dafür spielen, in welcher Atmosphäre Dialoge, Diskussionen, aber auch Lernprozesse ablaufen. Das „Bildungssofa“ war inhaltlich freilich ein wenig oberflächlich, aber lustig und anregend. Die zwei Educamp-Sessions, in denen ich war, fand ich jetzt nicht so weltbewegend anders und besser als andere Workshops. Eher sehe ich ähnliche Probleme, nämlich mangelnde Tiefe und Ergebnisorientierung. Aber das ist eine Frage des Zwecks (was auch in der Podiumsdiskussion am Mittwoch kurz zur Sprache kam), weshalb ich zunehmend der Meinung bin, dass wir verschiedene Tagungsformate auf keine Fall gegeneinander ausspielen sollten, denn: Sie dienen einfach verschiedenen Zielen. Damit will ich nicht sagen, dass diese Ziele immer erreicht werden – im Gegenteil: Die meisten Tagungsformate dürften Verbesserungen vertragen, um IHRE Ziele klarer zu erreichen. Aber das ist eine andere Folgerung als die, ein bestimmtes Format zum Königsweg zu erklären.
Die beiden Beiträge, die wir aus München eingereicht hatten (zum Peer Review und zur Erfassung empirischer Studien), hatten wir bewusst als interaktive Formate eingereicht, weil wir das mal ausprobieren wollten. Dabei habe ich bei mir festgestellt, dass ich interaktive Poster-Sessions recht anregend finde (Näheres zu unserem Beitrag findet sich bereits hier in Mandys Blog). Ich denke aber, dass dies nur für bestimmte Beitragsarten wirklich gut geeignet ist. Mit Learning Cafés dagegen werde ich persönlich nicht so recht warm. Das ist jetzt das zweite Learning Café, das ich mitgemacht habe, und ich kann da nicht allzu viel rausziehen, aber das ist eine persönliche Meinung. Jedenfalls würde ich mir wünschen, dass man weiter und mehr mit solchen Formaten experimentiert, wobei sich auf jeden Fall wesentlich mehr Einreicher entschließen müssten, daran teilzunehmen. Das war auf der GMW 2010 (also bei den Einreichungen) ausgesprochen dünn.
Gespannt war ich auch auf die Keynote-Beiträge. Wie zu erwarten, hat es Rolf Schulmeister mit seinem Vortrag zur „Invasion der beruflichen Bildung“ in die Universitäten wieder einmal sehr gut verstanden, zum Nachdenken anzuregen: Rolf lieferte eine akribisch genaue Beschreibung der sich scheinbar zyklisch wiederholenden Akademisierung der beruflichen Bildung, wobei er sich einen – leider falsch eingereihten – Seitenhieb auf die Universität der Bundeswehr einfach nicht verkneifen konnte. In ihrer Eindringlichkeit wird diese Darstellung sicher vielen im Gedächtnis haften bleiben. Am Ende war aber dann die Zeit für ein Fazit viel zu kurz. Eine Diskussion – hier vielleicht auch ein Learning Café – im Anschluss zur Auseinandersetzung mit den Folgen der dargestellten Entwicklung, wäre bestimmt höchst spannend gewesen. Weniger spannend dagegen fand ich die etwas langatmige Darstellung der Geschichte der Universität Straßburg und ihrer IT-Strategie – ich finde, das ist für einen Keynote-Vortrag eher wenig geeignet. Immerhin emotional bewegt, nämlich latent aggressiv gemacht hat mich der Herr von Disney Research – das hätte an sich gut an einigen Stellen in Rolfs Vortrag gepasst, an denen es um die Verflechtung staatlicher mit wirtschaftlichen Interessen ging. Die Botschaft des Films als Vorschau auf die GMW 2011 am Ende der Tagung schließlich ist mir leider verschlossen geblieben … aber vielleicht war ja das Medium die Borschaft?
Fazit: Es war für mich eine gelungene Tagung, weil sie Anker für Gespräche genauso wie Anker für Kritik und Anlässe zum Nachdenken lieferte, weil sie einfach auch an einem sehr schönen Ort stattfand und gut organisiert war, und weil es schön ist, immer wieder alt bekannte und neue Gesichter in einer alles in allem sehr angenehmen Atmosphäre zu sehen. Ich finde, das spricht eindeutig FÜR die GMW!


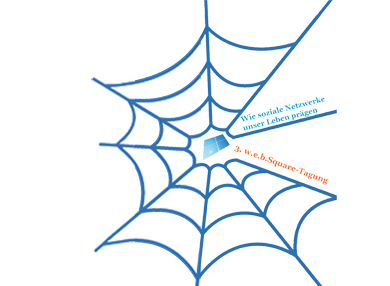 Zum dritten Mal fand im Rahmen unseres Studiengangs „Medien und Kommunikation“ gestern eine studentische Tagung statt, nämlich die dritte
Zum dritten Mal fand im Rahmen unseres Studiengangs „Medien und Kommunikation“ gestern eine studentische Tagung statt, nämlich die dritte  (es sei mir verziehen).
(es sei mir verziehen). Zwei Wochen liegt die
Zwei Wochen liegt die 
 Dass auch Studierende eine Tagung organisieren können, haben die Teilnehmer/innen einer Veranstaltung von
Dass auch Studierende eine Tagung organisieren können, haben die Teilnehmer/innen einer Veranstaltung von  Auf den Seiten der
Auf den Seiten der